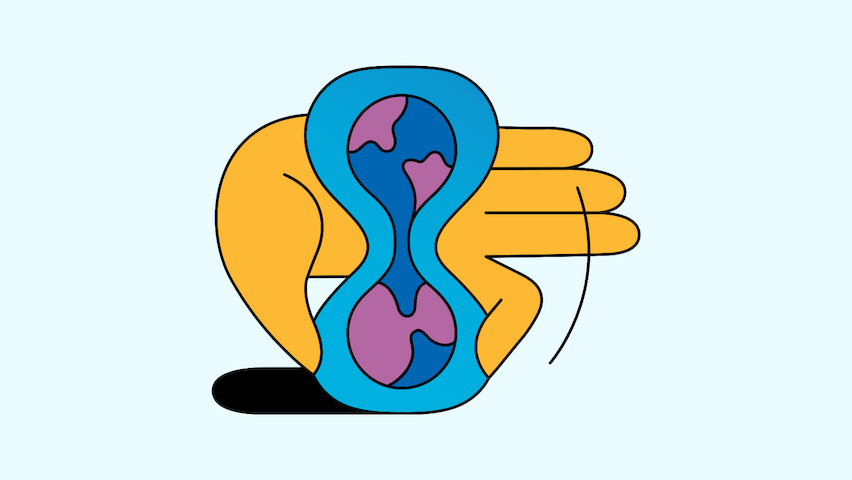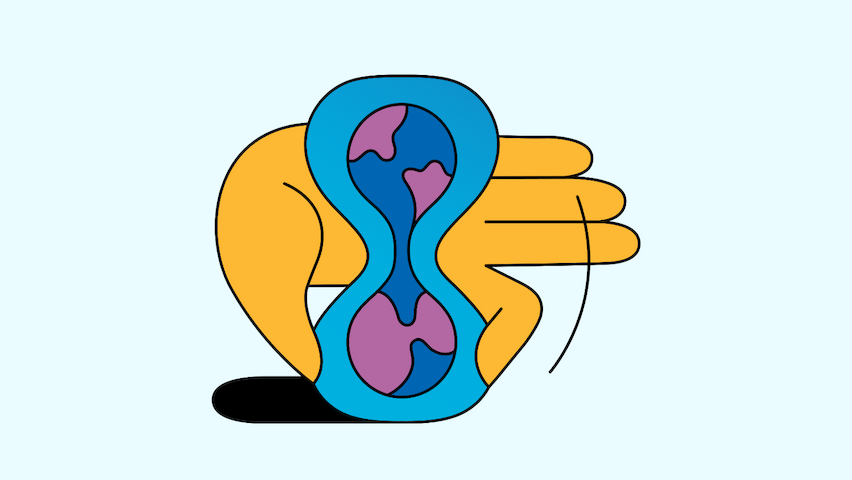Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Beinahe unbemerkt sind fünfzig Jahre seit dem Kniefall von Warschau und dreißig Jahre seit der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags vergangen – beide bedeutende Wegmarken einer Versöhnungspolitik, die Deutschland und Polen gestärkte Rollen innerhalb Europas ermöglichte.
Der Historiker Krzysztof Ruchniewicz erläutert, wie der Dialog das Verhältnis beider Nachbarn stärken kann: Von einer Überwindung der aktuellen politischen Irritationen bis zu gemeinsamen Zukunftsprojekten wie dem geplanten Polendenkmal in Berlin.
https://www.koerber-stiftung.de/ecommemoration/podcasts https://twitter.com/koerbergp https://www.facebook.com/KoerberStiftung/
„… für die sogenannte Kriegsgeneration waren bestimmte Handlungen, bestimmte Worte selbstverständlich – wir müssen alle diese Dinge selber lernen. Das heißt, wir haben das nicht mehr erlebt, wir müssen selber auch nach Antworten suchen. Und das sehe ich wirklich sehr problematisch. Wir haben selbstverständlich Vorbilder. Stichwortartig: Willy Brandt, Kniefall, Vorbild. […] Gleichzeitig aber stellt sich für uns immer die Frage, wie stehen wir heute zu diesen Fragen, zu diesen Problemen und so weiter? Und ist es die Historie, die uns Antworten auf unsere Probleme gibt? Ich habe damit ein großes Problem. Obwohl ich selber Historiker bin …“
Krzysztof Ruchniewicz, Historiker
Empfehlung
- Auf der Website der Universität Breslau finden Sie den 2021 von Jan Barcz und Krzysztof Ruchniewicz herausgegebenen Sammelband Akt der guten Nachbarschaft: 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, der neben Quellmaterial und Einordnungen von zeitgenössischen Akteuren auch heutige historische Einordnungen umfasst.
Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zu Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt und beeinflusst.
In dieser Folge geht es um Deutschland und Polen und das Verhältnis, das beide zu ihrer komplizierten und vielfach miteinander verwobenen Geschichte haben. Polen hat durch den deutschen Überfall von 1939 und den anschließenden Zweiten Weltkrieg unermessliches Leid erfahren –sechs Millionen Opfer sind bis heute Mahnung, diese Geschichte zu erinnern und angemessen zu würdigen. Zugleich gehört es zu den großen Errungenschaften der Nachkriegsgeschichte, dass beide Länder heute eine funktionierende und lebendige Nachbarschaft teilen. Von der neuen Ostpolitik der Bundesrepublik und dem Kniefall von Warschau im Dezember 1970 über den deutsch-polnischen »Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit« im Juni 1991 bis hin zum Beitritt Polens zur Europäischen Union im Jahr 2004: Es war die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen, die beiden Ländern gestärkte Rollen innerhalb des heutigen Europas ermöglichen sollte.
Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des Willy Brandt Zentrums für Deutschland- und Europastudien der Universität Wroclaw und Leiter des dortigen Geschichtslehrstuhls, spricht in unseren aktuellen Folge über die Bedeutung des Dialogs im Verhältnis beider Nachbarn. Wie aktuelle politische Irritationen überwunden werden können, wie das Denkmals an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in Berlin aussehen kann, aber auch wie das deutsch-polnische Verhältnis sich zukünftig entwickeln wird, danach fragte ihn mein Kollege Bernd Vogenbeck.
Bernd Vogenbeck: Ich würde gerne beginnen, Herr Ruchniewicz, mit der Beobachtung, dass jetzt in den anderthalb Jahren der Corona-Krise das Gedenken an vielen Stellen erschwert worden ist. Also 75 Jahre Kriegsende, aber auch die Deutsche Wiedervereinigung: All das, was man sonst so erwartet an Dingen, die rund um solche Gedenktage passiert, ist unterlassen oder erschwert worden. Trotzdem sind mir zwei Daten aufgefallen als besonders wenig sichtbar in der – zumindest deutschen – Öffentlichkeit. Fünfzig Jahre Warschauer Vertrag und der Kniefall Willy Brandts, und zuletzt jetzt auch dreißig Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag: Irgendwie hat das gar kein Echo gefunden. Ist das ein Zeichen für die Schwächung der deutsch-polnischen Beziehungen?
Krzysztof Ruchniewicz: Ja, vielen Dank für diese Fragen. Ich würde das vielleicht nicht so deuten auf den ersten Blick. Denn Sie haben die Corona-Krise genannt und Sie können sich vorstellen, dass die Polen in dieser Zeit ganz andere Probleme hatten und sich nicht unbedingt mit der Historie auseinandersetzen mussten. Aber Sie haben in der Tat zwei ganz wichtige Ereignisse angesprochen, die nicht nur von Bedeutung waren, sondern wo Sie auch zurecht attestiert haben, dass man ihnen sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es gibt auch einen anderen Grund: Im Vorfeld der Gedenkfeierlichkeiten gab es Äußerungen von Seiten polnischer Politiker der Regierungspartei, die an dem deutsch-polnischen Versöhnungsprozess gezweifelt haben. Der Kniefall von Willy Brandt steht eben für eine von diesen ganz großen Gesten von deutscher Seite. Diese Sühnebereitschaft des deutschen Bundeskanzlers damals war für alle selbstverständlich, also: Hier passiert etwas Wichtiges. Und es sollte vor allem in Polen verstanden werden, dass diese Sühnebereitschaft des deutschen Kanzlers, der mehr oder weniger für die Deutschen spricht, nicht nur gesehen, sondern auch anerkannt werden sollte. Und das wurde gerade im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten bezweifelt. Ob das doch nicht ein Manöver war, ob das nicht, wie soll ich das jetzt ausdrücken, vielleicht ein Vorwand war, um auf bestimmte Dinge nicht hinzuweisen. Der Hintergrund dieser Gedanken war die Reparationsfrage und die Diskussion, die in Polen stattgefunden hat über die angeblich nicht gezahlten Reparationen von Seiten Deutschlands. Das heißt, zumindest wollte man den Eindruck erwecken, ja da kommen immer wieder die deutschen Politiker, die über die Versöhnung reden, aber wenn man sie jetzt beim Namen nennt, dann haben sie keine konkreten Vorschläge, wie man zum Beispiel diese Reparationsfrage lösen kann. So ist vielleicht auch zu erklären, dass in der Öffentlichkeit dieses Datum, dieses Ereignis keine so wichtige Rolle gespielt hat.
Haben die Reparationsfragen, wenn man so möchte, überlagert, was eigentlich zu feiern gewesen wäre?
Diese Reparationsfrage ist keine neue Frage. Ich möchte in Erinnerung rufen: Schon Anfang des neuen Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts wurde diese Frage behandelt. Damals haben sich die beiden Regierungen Polens und Deutschlands geeinigt, dass man diese Frage nicht mehr aufwerfen wird. Nach 2015, nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch der PiS-Partei, wurde diese Frage auf einmal wieder aufgenommen und kommt immer wieder zur Sprache. Allerdings, und hier muss man auch einschränken: Bis heute hat die polnische Regierung keine Forderungen an die bundesdeutsche Regierung gestellt. Irgendwie schwebt diese Frage in der Luft und wird innerhalb Polens für die Zwecke der Regierungspartei instrumentalisiert.
Ist das eigentlich innenpolitischer – mehr, als es außenpolitisch ist?
Aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass es sich hier um die Innenpolitik handelt, um die Mobilmachung der eigenen Wähler, um zumindest ihnen deutlich zu machen, wie hart man gegenüber Deutschland handeln kann. Gleichzeitig aber, wenn man sich vergegenwärtigt, dass nach den Parlamentswahlen 2019 die Gruppe, die sich damit beschäftigen sollte, also diese Reparationsgruppe, nicht wieder gegründet wurde, dann zeigt das, dass der Stellenwert auch von Seiten der Regierungspartei niedrig gehalten worden ist. Also das heißt, es wird bei unterschiedlichen Anlässen immer wieder aufgegriffen, hat aber keine Bedeutung.
Und doch taucht das ja immer wieder auf, dieses innenpolitische Arbeiten mit Themen, die irgendwie an der Geschichte dranhängen, auch um den Preis, dass das zumindest international für Irritationen sorgt. Da hat es eine ganze Reihe von Beispielen gegeben in den vergangenen Jahren: Von den Fragen der Besetzung von Direktorenposten bei hochrangigen Museen in Polen bis hin zu Gesetzesinitiativen, die Frage der Entschädigungsansprüche von jüdischen Nachfahren, das Holocaust-Gesetz…
Was passiert da eigentlich? Können Sie diesen scheinbaren Widerspruch ein bisschen auflösen?
Die Regierungspartei möchte Deutungsmacht gewinnen in historischen Fragen. Und mein Eindruck ist, sie nutzt Geschichte als Instrument für die Innenpolitik. Man rechnet jetzt nicht damit, welche Auswirkungen diese Themen für die Außenwelt haben. Es reicht, sich zu vergegenwärtigen, welche Folgen diese Schritte hatten bzw. welche Erfolge damit erreicht worden sind. Wenn Sie zum Beispiel an das Novellierungsgesetz denken, also das »Holocaust-Gesetz«, dann mussten wir einen Rückzug machen aufgrund der Proteste, die in Amerika oder in Israel stattgefunden haben. Das letzte Beispiel mit dem Prozess gegen beide Historiker Engelking und Grabowski: Auch hier musste man einen Rückzug machen, weil in der zweiten Instanz beide Historiker von den Vorwürfen freigesprochen worden sind.
Hat das eigentlich einen Einfluss? Diese Entwicklungen rund um Geschichte, die politisch initiiert werden, beeinflusst das eigentlich das Arbeiten von Historikern in Polen heute?
Vielleicht nicht direkt, aber indirekt schon. Wir sehen schon, dass bei der Besetzung der Posten von großen Museen, wo bisher auch die Historiker beschäftigt waren, die nicht konform waren jetzt mit der jetzigen Regierung, dass sie abgesetzt worden sind oder durch die Kürzung der Gelder keine Möglichkeiten haben, ihre Institution weiterzuentwickeln. Also hier hat selbstverständlich der Staat genug Instrumente, um einzugreifen. Auf der anderen Seite wäre zu betonen, dass wir zwei Tendenzen in Polen im Moment haben, und das konnte man schon beobachten in den 90er Jahren. Auf der einen Seite war dies die kritische Auseinandersetzung mit eigener Geschichte. Das bedeutete, dass man in der eigenen nationalen Geschichte auch nicht nur positive Seiten hervorgehoben hat, sondern sich auch gleichzeitig immer wieder bemüht hat, wenn das notwendig war, auch die Schattenseiten oder die negativen Seiten zu bearbeiten. Stichworte: Die Aufarbeitung des Themas Vertreibung der Deutschen zum Beispiel oder dann der Umgang mit der ukrainischen Bevölkerung oder zuletzt auch die polnisch-jüdischen Beziehung. Wenn ich nur die Beziehungsgeschichte anspreche. Aber es gab auch eine andere Tendenz, die vor allem nach der sogenannten Jedwabne-Debatte zustande kam, nämlich diese affirmative Sicht auf die Geschichte oder die affirmative Beschäftigung mit Geschichte. Das heißt, man hat nicht mehr diese kritischen Seiten in der eigenen nationalen Geschichte gesehen, sondern versucht, sich auf positive Seiten zu konzentrieren in der polnischen Geschichte.
Könnten Sie das einmal kurz erläutern, Jedwabne-Debatte und was danach kam?
Das war eine ganz große Wende in der polnischen Debatte, weil erstmals an dieser Debatte die ganze Gesellschaft teilgenommen hat. Also nicht nur die Intellektuellen, nicht nur die Politiker, sondern auch ein Durchschnittspole. Das war von großer Bedeutung. Warum? Hier griffen nicht mehr die Schemata, die wir kannten – Ursache und Wirkung –, die für jeden Historiker selbstverständlich sind. Im Falle der Vertreibung der Deutschen konnten wir immer sagen: Ja, die Deutschen haben uns überfallen, angegriffen 1939, und sind dann vertrieben worden. Da konnte man also dieses Ursache-Wirkung-Schema ganz gut verwenden. Im Falle vom Jedwabne war das nicht möglich: Wir haben die Juden überfallen, wir haben die Juden ermordet. Also Bürger von dieser Kleinstadt Jedwabne im Osten Polens haben Teile ihrer jüdischen Brüder ermordet und jeder Pole musste sich mit dieser Frage konfrontieren. Wir sind auch selber Täter geworden, wir waren nicht nur Opfer der Geschichte. Also insofern war das eine Wende in dieser historischen Auseinandersetzung. Gleichzeitig aber kam auch diese affirmative Sichtweise, wo man nicht mehr zugeben wollte, dass man unter Umständen auch zum Täter werden konnte. Das war nach dem Wechsel der Macht am Institut des Nationalen Gedenkens auch ganz sichtbar: Dass man beschlossen hat, sich nicht mehr kritisch mit den polnisch-jüdischen Beziehungen auseinanderzusetzen.
Es gibt ja durchaus auch gute Gründe dafür, dass man das vorbildliche Verhalten, das es ja auch gegeben hat während der Besatzung Polens im Nationalsozialismus, dass man dieses vorbildliche Verhalten auch stärker akzentuiert?
Ich glaube, es ist etwas Selbstverständliches und zeigt die Reife einer Nation oder einer Gesellschaft, dass sie auf diese negativen Seiten auch kritisch eingehen kann. Und hier habe ich ein Problem: Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass gerade die Nationalkonservativen dabei sind, andere Sichtweisen zu stärken, neue Identität zu schaffen. Und diese Identität schafft man, wenn man Alternativen vorgibt, die sehr oft populistisch konnotiert sind. Dann ist diese kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte irrelevant, denn an dieser Stelle sollte wirklich der Stolz auf eigene Errungenschaften im Vordergrund stehen. Es gab die Zeit der 1990er Jahre, wo die Polen nicht mit der Geschichte beschäftigt waren, sondern mit der Transformation. Dann kamen die Nationalkonservativen, die versucht haben deutlich zu machen, dass man durch die Vernachlässigung der Geschichte es so weit gebracht hat, dass das Ausland vor allem die Geschichte Polens nicht versteht, die Rolle Polens nicht versteht. Dass Polen jetzt eine neue, sagen wir mal so, eine neue Bedeutung gewinnen muss. Es gab selbstverständlich, das muss man auch hier zugeben, auf Seiten des Auslandes Probleme. Stichwortartig: Die sogenannten polnischen Konzentrationslager.
Das ist die verkürzte Darstellung in westlichen Medien, teilweise auch von westlichen Politikern verwendet, dass man sagt, die in Polen gelegenen Konzentrationslager, was für ein historisch ungebildetes Publikum suggeriert, dass es Konzentrationslager von Polen gewesen seien. Dabei sind es letztlich nationalsozialistische deutsche Konzentrationslager, die auf dem Gebiet des heutigen Polen liegen.
Man konnte damit ganz klar und deutlich machen: Diese kritische Auseinandersetzung, die im Lande stattgefunden hat, wird vom Ausland missverstanden. Das heißt, sie wird als Grund genommen, um Polen an den Pranger zu stellen. Und das war für die Nationalkonservativen zu viel.
Geschichte wird dann zu einem Ort, wo man die eigene Position stärken muss, wo man einstehen muss für seine eigenen Belange?
Das ist richtig, aber das trifft nicht immer zu. Also das heißt, bei den liberalen Gesellschaften, die wir immer noch sind in Europa, spielt die Geschichte eher eine zweitrangige Rolle. Aber bei den Nationalkonservativen spielt die Identität eine ganz wichtige Rolle. Und hier eignet sich Geschichte, um sich bestimmte Kontinuitäten vor Augen zu führen.
Wenn Geschichte eine Identitätsfrage ist, die letztlich ins Politische hineinragt, was können wir dann sehen in dem Umgang mit dreißig Jahren Vertrag über deutsch-polnische Nachbarschaft? Mit fünfzig Jahren Kniefall von Willy Brandt? Diese beiden Dinge sind ja durchaus verbunden mit der schwierigen Geschichte des Zweiten Weltkriegs und dem Versöhnungsprozess, der nach 1945 einsetzen konnte. Und weil es eben auch um den Versöhnungsprozess geht, geht es dann auch um die Fragen von Identität als Opfer oder als Akteur? Lässt sich da etwas sagen über die politische Wahrnehmung des Versöhnungsprozesses nach 1945 in Polen?
Das zeigt vielleicht, dass der Versöhnungsprozess auf Eliten beschränkt war. Also das heißt, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, stärker in die Gesellschaft zu wirken. Das klingt auf der einen Seite paradox, denn Sie können mir genug Beispiele nennen, Organisationen, Verbände, die sich für diesen Versöhnungsprozess eingesetzt haben. Aber wir sehen jetzt schon mit dem Generationenwechsel – hier möchte ich auch ganz stark auch betonen: für die sogenannte Kriegsgeneration waren bestimmte Handlungen, bestimmte Worte selbstverständlich – wir müssen alle diese Dinge selber lernen. Das heißt, wir haben das nicht mehr erlebt, wir müssen selber auch nach Antworten suchen. Und das sehe ich wirklich sehr problematisch. Wir haben selbstverständlich Vorbilder. Stichwortartig: Willy Brandt, Kniefall, Vorbild. Oder wir können auf der polnischen Seite Władysław Bartoszewski nennen zum Beispiel, auch ein Vorbild. Gleichzeitig aber stellt sich für uns immer die Frage, wie stehen wir heute zu diesen Fragen, zu diesen Problemen und so weiter? Und ist es die Historie, die uns Antworten auf unsere Probleme gibt? Ich habe damit ein großes Problem. Obwohl ich selber Historiker bin, spreche ich eigentlich dagegen. Aber auch meine Beobachtung ist, was wir brauchen, wir brauchen gemeinsame Projekte, die uns für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft binden für mehrere Jahre: Angefangen jetzt mit der Energiekrise, der Migrationskrise, dann zum Beispiel die Umweltschutzkrise. Ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich ganz andere Themen, wenn von beiden Seiten diese Bereitschaft da wäre, sich mit diesen schwierigen Fragen, die anstehen, gemeinsam auseinanderzusetzen. Da würde sicherlich die Nachbarschaft ganz anders aussehen. Und Geschichte aus meiner Perspektive, um jetzt den letzten Satz abzuschließen, würde in diesem Kontext ganz anders aussehen. Denn die Historie würde uns zeigen: Ja wir haben es doch gelernt, miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten und wir haben gemeinsame Projekte, die anstehen, und nicht immer dieser Blick nach hinten.
Sie haben mal die Frage aufgeworfen, wer sich eigentlich heute versöhnen soll. Die Frage wird natürlich umso drängender vor dem Hintergrund, dass die Erlebnisgeneration inzwischen nicht mehr bei uns ist oder immer mehr in die Schatten tritt. Wer soll sich eigentlich versöhnen und worüber, wenn die Menschen, die angesprochen werden sollen mit einer Politik der Versöhnung, damit nichts anfangen können? Es benennt, glaube ich, den Punkt, wo die Frage aufkommt, warum können eigentlich junge Menschen, die den Krieg nicht erlebt haben und nur aus zweiter oder gar dritter Hand mitbekommen haben, heute nur mit so vielen Vorbehalten reagieren auf eine Politisierung dieser Vergangenheit. Sei es auf der polnischen oder auf der deutschen Seite: Was brauchen wir da?
Mein in diesem Jahr verstorbener Kollege hat vor Jahren diese Frage auf folgende Weise formuliert: Wer sich versöhnen sollte, hat sich versöhnt. Er meinte selbstverständlich die Erlebnisgeneration. Wer sich aber nicht versöhnen wollte, hat sich nicht versöhnt, das müssen wir als Nachgeborene akzeptieren. Und ich bin einverstanden mit dem, was mein Kollege Borodziej damals formuliert hat: Wir sollten eigentlich nicht von der Versöhnung sprechen, sondern eher fordern, dass wir uns besser verständigen, dass wir besser auskommen, dass wir miteinander kommunizieren. Vielleicht erinnern Sie sich an eine Karikatur, die den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen am Beispiel von zwei Brücken zeigt? Es gab eine deutsch-französische Brücke und Sie können sich vorstellen, der Verkehr war ungestört in beide Richtungen. Aber im Vordergrund stand eine deutsch-polnische Brücke und es gab mittendrin ein Loch und auf beiden Seiten standen der polnische Premierminister Tadeusz Mazowiecki und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Und sie wollten sich über dieses Loch die Hände anreichen, aber es reichte nicht. Deswegen mussten sie Prothesen benutzen. Das war die Erlebnisgeneration oder die erste Generation, die im Krieg geboren wurde. Heute über Versöhnung zu sprechen, da würde ich eher über Versöhnung in der Vergangenheit sprechen, dagegen aber diesen Begriff der Versöhnung zum Anlass nehmen, um deutlich zu machen, welchen Weg Polen und Deutschland, also sprich nicht nur die Bundesrepublik Deutschland aber auch die DDR, zurücklegen mussten, um miteinander in Europa heute auszukommen. Und für die Jugendlichen ist das selbstverständlich. Stoff genug, um darüber zu diskutieren, wie der Stand der Dinge ist und was die Polen und Deutschen im Moment verbindet und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Gleichzeitig aber glaube ich, dass sie nicht viel mit Geschichte heute anfangen können oder wollen, dagegen aber eher gegenwarts-, was auch selbstverständlich ist, oder zukunftsorientiert sind. Und da sehe ich eine ganz große Chance.
Ja. Die Kritik von Włodzimierz Borodziej zielte ja auch darauf, dass man Versöhnung nicht als Ziel begreifen kann, sondern dass das ein Prozess ist, der andauert, der auch immer wieder erneuert werden muss. Und Sie sprachen gerade davon, wie viel eigentlich geleistet werden musste: Zu dieser Versöhnung gehörte politisches Bemühen, es gehörten rechtliche Fragen, die zu klären waren, es gehörte gesellschaftliches Engagement von den Kirchen bis hin zur Kultur. Auf sehr sehr vielen Ebenen. Sie haben gerade auch noch mal angesprochen: Ein Elitenprojekt. Und ja, das zeigt sich, selbst wenn man runtergeht auf die unteren Ebenen und sich anschaut, wer betreibt das eigentlich. Es ist oft einfach etwas, was auf einer Ebene von Eliten als intellektuelles Projekt vorangetrieben wird, das ist die eine Seite der »Versöhnung«. Ich glaube, die Versöhnung von Deutschen und Polen findet auch auf einer ganz anderen Ebene sehr sehr unausgesprochen, sehr unaufgeregt, sehr pragmatisch statt. Es gibt meines Wissens kein Land, mit dem Deutschland so enge persönliche Beziehungen pflegt wie Polen. Also im Sinne von, wie viele Menschen haben einen polnischen Hintergrund in Deutschland, wie viele Menschen aus Polen arbeiten in Deutschland. Die deutsche Gesellschaft ist eigentlich durchsetzt mit polnischen Einflüssen, die einfach eingesickert sind in diese deutsche Gesellschaft und das ist irgendwie etwas, was wir gar nicht wahrnehmen. Und weil es aber demgegenüber so ein Elitenprojekt geblieben ist, politisch darüber zu reden, lässt es sich auch instrumentalisieren. Gleichzeitig steht dem aber auch eine gewisse Entspanntheit gegenüber, würde ich fast sagen, wenn ich mir Deutsche und Polen anschaue, die wirklich diese deutsch-polnischen Beziehungen leben.
Ja, bin vollkommen bei Ihnen da und einverstanden. Ich würde vielleicht zu dieser Instrumentalisierung noch Polarisierung hinzufügen. Das wäre auf der einen Seite, was vielleicht auf dieser Ebene läuft, sprich jetzt die hohe Politik. Aber gleichzeitig und danke, dass Sie auch diese anderen Ebenen angesprochen haben, diese menschliche Ebene. Eben eine der großen Folgen der Ereignisse von 1989/90 war, dass die beiden Gesellschaften zum ersten Mal in der Geschichte, abgesehen wirklich von einer ganz kurzen Zeit der 70er Jahre, wo die Grenzen geöffnet worden waren für die DDR-Bürger und die Bundesbürger und gleichzeitig auch für Polen, dass sie auch in diese beiden Staaten reisen durften, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte nach 1945 persönlich kennenlernen konnten, dass sie sich sogar gegenseitig besucht haben. Deswegen komme ich noch mal zurück auf diese Idee gemeinsamer Projekte. Von einem gemeinsamen Projekt können wir sprechen, zum Beispiel: Das deutsch-polnische Geschichtsschulbuch ist auch eine Initiative, die ganz unten ansetzen sollte. Also das heißt, mit den Schulen, dass zum ersten Mal die Polen und die Deutschen sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen. Es geht nicht um ein Schulbuch für die deutsch-polnischen Beziehungen, das wäre dann aus meiner Perspektive zu kurz gegriffen, sondern es geht um ein reguläres Geschichtsschulbuch an den polnischen und deutschen Schulen.
Können Sie kurz die Genese erläutern?
Ja, nach der Veröffentlichung des deutsch-französischen Geschichtsschulbuches ist man auf die Idee gekommen, wieso kann man nicht in dem deutsch-polnischen Bereich auch ein gemeinsames Schulbuch entwickeln? Dann haben sich die beiden Außenminister, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der heutige Präsident, und der polnische Außenminister Sikorski geeinigt: Wir sollten auch ein solches Schulbuch entwickeln lassen, denn das bringt uns sicherlich näher. Sie können sich vorstellen: Nach der Bekanntgabe dieses Projektes gab es nicht im deutschen Bundestag, aber im polnischen Parlament eine hitzige Debatte. Da muss man sich einmal vergegenwärtigen, 2007/08, dass man, zumindest auf der Seite der Nationalkonservativen, mehr oder weniger die Angst geäußert hat, die Deutschen werden unsere Geschichte umschreiben. Also diese Ängste, die wir heute auch immer wieder zu hören bekommen, die gab es auch damals. Aber interessant ist, wenn Sie jetzt das Werk zur Hand nehmen, dass es den beiden Seiten gelungen ist eine gemeinsame Erzählung zu entwickeln, dass ein gemeinsames Schulbuch entstanden ist. Und was ich von großer Bedeutung finde: Auch die Differenzen sind ganz klar und deutlich in diesem Schulbuch vermerkt worden. Also ich nenne das als Differenzprotokoll. Das heißt, wo jeder Lehrer auf beiden Seiten die Möglichkeit hat, sich mit diesen Differenzen nicht nur bekannt zu machen, sondern mit den Schülern darüber zu sprechen. Das finde ich wirklich wunderbar. Es geht darum, dass wir uns durch die Geschichte annähern. Dass wir vielleicht Geschichte zum Anlass nehmen, auch diese Differenzen zum Anlass nehmen, um darüber zu diskutieren. Stellen Sie sich jetzt vor, und das kann sich jeder Hörer von unserem Gespräch wahrscheinlich vorstellen: Wenn es Differenzen gibt, dann muss ich nachschlagen, dann muss ich vielleicht ein bisschen tiefer gehen, um das besser zu verstehen. Und so verstehe ich auch dieses Werk.
Ich habe gelernt, Versöhnung beruht auf Dialogbereitschaft, Konsensfähigkeit und wechselseitiger Empathie. Das sind alles drei Dinge, die Sie genau benennen an diesem Beispiel. Ein weiterer Punkt ist in den letzten Jahren in der Debatte aufgekommen und soll eigentlich auch in diesen Tagen versehen werden mit einem neuen Impuls: Das ist die Frage des sogenannten Polendenkmals in Berlin. Was ist das, können Sie uns das kurz einmal vorstellen? Und auch die Hoffnungen, die, glaube ich, auf der polnischen Seite an dieses Projekt geknüpft werden, dass da vielleicht mehr passieren kann auch in der deutschen Öffentlichkeit und in der deutschen Wahrnehmung als das bisher der Fall war.
Zur Vorgeschichte dieses Projektes ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass das kein neues Projekt ist. Also dass man ein polnisches Zeichen in Berlin setzt, das war schon eine Idee des ehemaligen polnischen Außenministers Władysław Bartoszewski. Aber es meldeten sich später auch andere Politiker, die die Bedeutung eines solchen Zeichens gesehen haben. Jetzt aber – und es scheint, dass tatsächlich diese Idee umgesetzt wird – hat jetzt der Deutsche Bundestag beschlossen, unter anderem ein Zeichen in Berlin zu setzen, wo an die Okkupation Polens erinnert wird. Denn man hat zurecht schon vor vielen Jahren attestiert, dass, obwohl es sehr viele unterschiedliche Denkmäler, Gedenkstätten in Berlin gibt, es keinen Ort gibt, wo man an die polnischen Staatsbürger erinnern kann, die während des Zweiten Weltkrieges das Leben verloren haben. Und gleichzeitig, dass man einen Ort schafft, wo man darüber diskutiert, wo man sich austauscht, wo man nicht nur gedenkt, sondern auch diskutiert. Und vor allem ist dieses Projekt nicht nur an eine Gruppe, zum Beispiel ältere Bürger, gerichtet, sondern vor allem an die Jugendlichen. Das heißt, dass die Jugendlichen sehen, wie schwierig dieser Prozess des Zueinanderkommens war und gleichzeitig, welche Folgen auch der Krieg haben kann. Und wie es wichtig ist, aus Feindschaft Schlüsse zu ziehen und sich durch gemeinsame Diskussionen anzunähern. Und ich denke, das ist etwas, was bisher in der Hauptstadt gefehlt hat. Ich kann mir vorstellen, dass nach den Wahlen in Deutschland und nach der Konstituierung des neuen Bundestages dieses Projekt nicht nur erstgenommen wird, sondern auch über die Notwendigkeit dieses Projektes weiter diskutiert wird.
Herr Professor Ruchniewicz, ob wir noch einmal zurückkommen könnten zur Frage des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Und zwar bietet der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von 1991 ja auch eine Möglichkeit darüber nachzudenken, wie Deutsche und Polen über dreißig Jahre zueinander gefunden haben. Es ist ja durchaus auch ein Vertragswerk, das eine Grundlage darstellt für die gesellschaftliche, wirtschaftliche, rechtliche Zusammenfindung von diesen zwei Ländern und seinen Gesellschaften. Zugleich ist es auch etwas, was ein Grundstein war für eine ganz neue Situation für Polen. Polen, das muss man sich dann noch mal vergegenwärtigen, ein Land, das 1918 nach 123 Jahren Nichtexistenz wiedererstanden ist, 1939 besetzt wurde, nach 1945 in einen sowjetischen Machtbereich gelangt ist und dann eigentlich nach 1989 / 90 wieder anfängt, sich in seiner Nachbarschaft zu orientieren und dort auch eine neue Rolle sucht. Da hat dieser Nachbarschaftsvertrag auch eine Rolle gespielt.
Ja, das war der Höhepunkt auch der polnischen Bemühungen, nach der Wende die Beziehungen nach außen zu entwickeln. Man muss vielleicht in Erinnerung rufen, dass dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag ein anderer Vertrag vorangestellt war, nämlich der Vertrag über die Bestätigung der bestehenden Grenze. Das war ganz wichtig, denn das war einer der größten Konflikte, die es zwischen Polen und Deutschland nach nach 1945 gegeben hat. Beide Verträge muss man gemeinsam sehen als Vertragswerk und beide Verträge haben Rahmen geschaffen für die heutigen Beziehungen. Sie haben ganz deutlich gezeigt, dass die deutsch-polnischen Beziehungen nicht mehr von den Politikern selbst abhängen, die in irgendwelchen Sälen Abmachungen schließen, sondern von den beiden Bevölkerungen. Weil in dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag auch die Bevölkerungen angesprochen worden sind. Es reicht jetzt auch, sich zu vergegenwärtigen, was danach folgte, in den nächsten Wochen, Monaten. Zum Beispiel wurde das sogenannte Weimarer Dreieck ins Leben gerufen. Denn einer der Wünsche Polens war damals, sich schnell mit Westeuropa zu vereinigen, man hat aber eine Zwischenlösung gefunden, nämlich die Schaffung des Weimarer Dreiecks. Und in diesem Jahr begehen wir auch den 30. Jahrestag der Entstehung des Weimarer Dreiecks. Es wurde damit eine interessante Plattform geschaffen zwischen Paris, Berlin und Warschau, um Polen mehr oder weniger vorzubereiten auf das was kommt. Das heißt, dass man nicht mehr bilateral agiert, sondern multilateral. Dass man sich irgendwie auf die neue Situation nach dem EU-Beitritt Polens vorbereitet. Es wird heute sehr oft gesagt, dass dieses Gebilde tot sei. Aber nicht nur die Erschaffung des Weimarer Dreiecks war damals wichtig, sondern auch die Schaffung des deutsch-polnischen Jugendwerkes: Zum ersten Mal kam es auch zu diesem ganz regen Austausch zwischen den Jugendlichen. Und die Vielzahl von Projekten, die inzwischen gemacht worden sind, sprechen auch für sich. Also Sie sehen schon, dass das deutsch-polnische Vertragswerk nicht nur Grundlagen geschaffen hat, das ist auch richtig, aber auch gleichzeitig einen Rahmen, der von den Bevölkerungen Polens und Deutschlands selbst mit Leben gefüllt werden konnte. Und das empfinde ich schon als – ich bitte um Entschuldigung, wenn dieses Wort aus der DDR-Sprache benutze – die größte Errungenschaft dieser Nachbarschaft: Dass man tatsächlich weg von der Politik war und versucht hat, die Gesellschaften aufzufordern zum gemeinsamen Austausch. Und abschließend lässt sich dann auch vielleicht in Erinnerung rufen, dass auch die Europa-Universität Viadrina damals gegründet worden ist. Ursprünglich sollte diese Universität, wenn ich mich recht daran erinnere, auch der deutsch-polnischen Nachbarschaft dienen, was auch der Fall ist. Das ist auch von großer Bedeutung zu betonen.
Ich kann als Absolvent der Viadrina davon …
…bitte schön…
… auch ein Lied singen.
Das heißt, Sie können das besser nachvollziehen, wie man damals schon auf diesen unterschiedlichen Ebenen gedacht hat. Was man versucht hat in Bewegung zu setzen in der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Warum? Weil man sich damals auf polnischer und auf deutscher Seite dessen bewusst war, dass Polen und Deutschland eine Nachbarschaft verbindet aber gleichzeitig, dass die Wiedererlangung der polnischen Souveränität 1989 und die Wiedervereinigung Deutschlands neue Chancen für die Nachbarschaft schafft. Und neue Impulse auch geben kann. Und von dieser Aufbruchsstimmung, glaube ich, haben wir alle profitiert.
Sie haben das auch gerade dargestellt als einen Moment der außenpolitischen Emanzipierung Polens und das finde ich eine wunderbare Perspektive auf diesen Vertrag, die ihn auch wirklich, glaube ich, da fokussiert, wo er historisch hingehört. Ich würde gerne noch die Gegenposition dazu einmal in den Blick nehmen. Mir war das persönlich gar nicht bewusst, aber Sie beschreiben das an einer Stelle in Ihrem Band zu diesem Vertrag sehr eingängig: Wie ist das eigentlich, was ist passiert in Polen an dem Tag, an dem in Berlin die Mauer fiel? Und wie hängen diese Dinge so zusammen, dass man eigentlich auch sagen kann, der Moment, als die Mauer fiel, dieser vielleicht glücklichste Moment der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, ist gleichzeitig verbunden mit einer kleinen Anekdote, die in Polen stattfindet an den Tagen davor und danach. Können Sie uns das einmal einfach nur aus Ihrer Perspektive schildern? Ich fände das eine Bereicherung für unser Publikum, mal zu hören, wie sich deutsche und polnische Geschichte um diese Zeit herum doch so nah waren.
Ja, es wird sehr oft vergessen, dass zu dieser Zeit ein Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl anstand. Ein Besuch, der schon seit längerer Zeit geplant war. Und Helmut Kohl, das müssen Sie sich vorstellen, reist in ein Polen als ein Vertreter des bundesdeutschen Staates. Und Polen hatte nur mit einem deutschen Staat zu tun. Auch die Polen damals…
…am 09. November war das…
Genau, auch bei dem Empfang haben die Polen damals nicht gedacht, dass innerhalb von wenigen Stunden diese Sichtweise sich völlig verändern kann. Dann kam es zum Fall der Mauer und für einen Tag hat der Bundeskanzler gebeten, nach Berlin zu fahren. Und dann war in Polen auf einmal wirklich ein Chaos ausgebrochen. Wie können wir uns jetzt positionieren? Wir haben es nicht mehr mit einem Staat zu tun, sondern wir haben es jetzt mit dem vereinigten Deutschland zu tun – und wie können wir uns selber positionieren? Das waren wirklich ganz wichtige Fragen. Interessant ist, dass nach der Rückkehr des deutschen Bundeskanzlers es auch zu der sogenannten Versöhnungsmesse kommt…
…das ist dann am 12. November, das ist wirklich zwei Tage später…
12. November, genau zwei Tage später. Das heißt, dass man vielleicht dann doch nicht so große Angst haben sollte vor diesem Deutschland, das im Entstehen begriffen ist. Allerdings, und das muss man vielleicht auch deutlich sagen, was die Polen damals vor allem beschäftigt hat: Wird das vereinigte Deutschland die Oder-Neiße-Grenze anerkennen oder nicht? Und diese Frage der Oder-Neiße-Grenze spielte für polnische Politiker eine ganz wichtige Rolle, sogar die Frage der Reparationen war irrelevant, war damals nicht von Bedeutung. Sondern ob die Polen dann doch von dem vereinigten Deutschland diese Grenze bestätigt bekommen. Das war die große Angst. Und deswegen kam es von der deutschen Seite manchmal zu Irritationen: Weswegen die Polen die ganze Zeit die Bestätigung dieser Grenze fordern? Das konnten sie nicht so richtig verstehen. Das muss man vielleicht damit erklären, dass im Zuge der Ost-West-Verschiebung Polen im Zweiten Weltkrieg die Hälfte seines Territoriums verloren hat. Und ohne diesen Zuwachs im Westen konnte sich Polen nicht normal entwickeln. Und diese Angst war in dieser Generation sehr vorhanden.
Zugleich war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, zu der es ja durchaus auch eine Vorgeschichte gibt – das ist ja, wenn man so möchte, der abschließende Lackmus-Test auch dafür, dass Deutschland sich löst von dieser Nachkriegssituation, wo auch Vertriebene und auch größere Teile der Bevölkerung über lange Zeit noch eine Vorstellung mit sich tragen, dass so etwas zurückgedreht werden kann. Und es ist der Moment, wo wirklich dann auch nach vorne geguckt wird. Ist es jetzt zu pathetisch, an der Stelle zu sagen, dass eigentlich sowohl Deutsche als auch Polen gleichzeitig gelernt haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu blicken in dieser Zeit, wo dieser Vertrag entstanden ist?
Ich denke schon. Denn wir haben nicht viele Verträge geschlossen, von denen wir jetzt nicht reden bzw. die wir vergessen haben. Wenn Sie zum Beispiel den deutsch-polnischen Vertrag über die Bestätigung der bestehenden Grenze an Oder und Neiße denken: Keiner hat nach 30 Jahren an diesen Vertrag erinnert. Denn dieser Vertrag ist umgesetzt worden und seit der Unterzeichnung dieses Vertrages stellt keiner diese Grenze infrage. Also hat der Vertrag seine Aufgabe erfüllt. Wir haben nicht viele solche Verträge. Auch der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag: Da wird das oder jenes bemängelt, obwohl wir immer vom Rahmen sprechen, da gibt es Themen und Fragen, die vielleicht heute an Aktualität verloren haben. Es gibt Fragen, die nicht angesprochen worden sind, wie zum Beispiel die Eigentumsfrage und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber sehen wir: Ja, es gibt solche Verträge, die mehr oder weniger abgeschlossen sind und an die sich keiner erinnert, obwohl die Themen, die sie behandelt haben, wie die Oder-Neiße-Grenze, wirklich immer wieder für neue Konflikte zwischen Polen und Deutschland gesorgt haben. Und gleichzeitig haben wir andere Verträge, wie den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, der trotz aller Schwächen nach wie vor für uns gilt. Also das heißt, wir können uns selbstverständlich vorstellen, einen neuen Vertrag auszuhandeln, aber wir brauchen diesen Vertrag nicht. Denn dieser Vertrag hat tatsächlich Rahmen geschaffen und wir können uns in diesem Rahmen nach wie vor bewegen. Trotz der verstrichenen Zeit. Und auch die Diskussionen in diesem Jahr haben deutlich gemacht, dass es keinen Sinn hat, hier an diesem Vertrag etwas zu verändern. Das war nicht das Thema.
Zugleich, Herr Professor Ruchniewicz, kommt bei mir da gleich die Frage auf: Wir haben vor gar nicht so langer Zeit den sogenannten Elysee-Vertrag erneuert, auch als politisches Signal, dass Frankreich und Deutschland stärker zusammenarbeiten wollen. Und der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag wird ja auch durchaus in einem Atemzug mit dem Elysee-Vertrag genannt – in dem Sinne, als eine wie auch immer konstruierte historische Erbfeindschaft überwunden worden sei durch eben diese Verträge. So. Lange Rede, kurzer Sinn, Frage: Gäbe es nicht eigentlich genug Bedarf, einen deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag und Freundschaftsvertrag noch mal neu zu formulieren und sich zu vergewissern wo man steht und wie man gemeinsam nach vorne gehen möchte?
Also es ist wirklich für mich eine große Freude, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich spiele das zurück. Ich hoffe, ich schieße kein Tor, aber gut: Wie viele Jahre haben die Bundesdeutschen und Frankreich gebraucht, um diesen Vertrag zu erneuern? Fünfzig, das war der Grund. Also fünfzig Jahre danach. Das heißt, wir haben noch zwanzig Jahre Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen. Also nein, das ist auch selbstverständlich, glaube ich, weil die Kriegsgeneration, also diejenigen, die damals diesen Vertrag unterschrieben haben, also ich spreche jetzt von dem deutsch-französischen Vertrag, nicht mehr leben. Man kann sich selbstverständlich immer wieder erinnern, welche Folgen dieser Vertrag hatte, aber fünfzig Jahre danach, das ist inzwischen die zweite, dritte Generation. Ich kann mir gut vorstellen, wir haben in diesem Jahr den dreißigsten Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages begangen, dass wir vielleicht in zwanzig Jahren dieses Gespräch wiederaufnehmen können, um kritisch zu fragen: Hat dieser Vertrag für uns noch eine Bedeutung, oder hat an gewisser Aktualität verloren, oder ist es nicht vielleicht an der Zeit, wie im Falle von Deutschland und Frankreich fünfzig Jahre danach, noch einen Erneuerungsvertrag zu unterzeichnen? Also ich finde, das gefällt mir wirklich sehr. Das werde ich mir merken. Und vielleicht können wir in zwanzig Jahren auf diesen Vorschlag von Ihnen zurückkommen und dann sehen, wie der Stand der Dinge ist?
Wunderbar, es wäre eine Freude und Ehre. Herr Ruchniewicz, dann danke ich sehr herzlich für dieses wirklich sehr weitgehende Gespräch.
Das war unser History and Politics Podcast mit Krzysztof Ruchniewicz zur Geschichte und Gegenwart der Deutsch-Polnischen Beziehungen, dreißig Jahre nach Unterzeichnung des gemeinsamen Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website unter dem Manuskript der aktuellen Sendung:
- Auf der Website der Universität Breslau finden Sie den 2021 von Jan Barcz und Krzysztof Ruchniewicz herausgegebenen Sammelband Akt der guten Nachbarschaft: 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, der neben Quellmaterial und Einordnungen von zeitgenössischen Akteuren auch heutige historische Einordnungen umfasst.

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 Min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 Min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 Min. 26. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 Min. 12. Mrz 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 Min. 5. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 Min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 Min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 Min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 Min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 Min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 Min. 12. Dez 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 Min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 Min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 Min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 Min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 Min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 Min. 30. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 Min. 9. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 Min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 Min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 Min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 Min. 28. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 Min. 14. Mrz 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 Min. 7. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 Min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 Min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 Min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 Min. 6. Dez 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 Min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 Min. 21. Okt 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 Min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 Min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 Min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 Min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 Min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 Min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 Min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 Min. 31. Mai 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 Min. 3. Mai 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 Min. 8. Mrz 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 Min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 Min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 Min. 28. Okt 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 Min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 Min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 Min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 Min. 25. Mrz 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 Min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 Min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 Min. 17. Dez 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 Min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 Min. 19. Okt 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 Min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 Min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 Min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 Min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 Min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 Min. 6. Mai 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 Min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 Min. 27. Mrz 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 Min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 Min. 23. Okt 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 Min. 1. Okt 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 Min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 Min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 Min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 Min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 Min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 Min. 28. Mai 2019