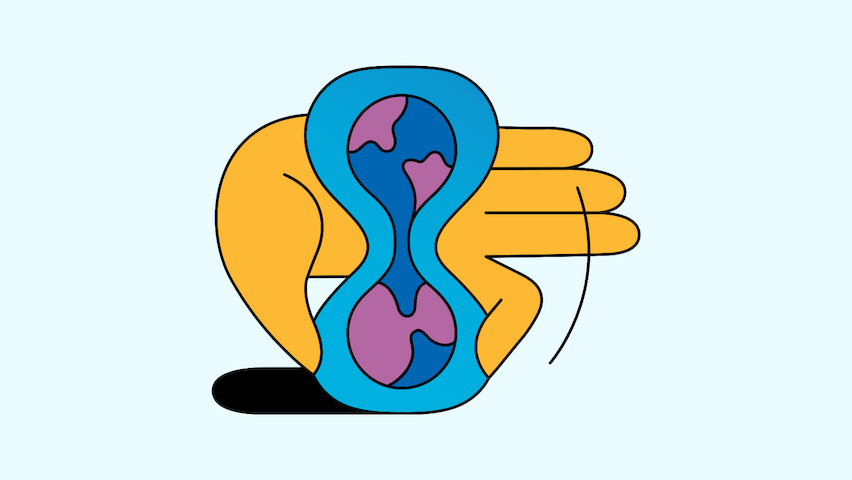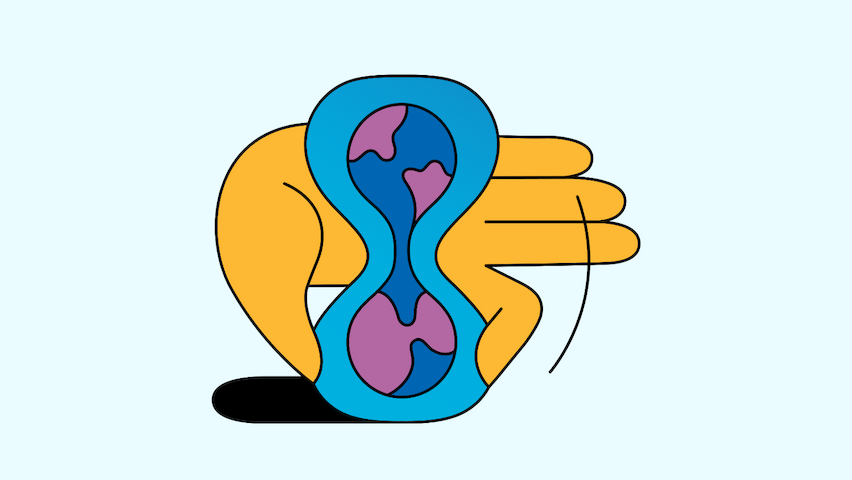Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Von neuen Anfängen, bleibender Erinnerung und der Suche nach Normalität
Unter welchen Bedingungen konnten Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg im Land der Täter ihr Leben wieder aufbauen und wie hat sich das Zusammenleben zwischen ihnen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft seither verändert? Wie sehr ist jüdisches Leben heute in Deutschland heute durch Antisemitismus und rechte Hasskriminalität bedroht? Und welche Chancen gibt es, dass Jüdischsein trotz der notwendigen Erinnerung an nationalsozialistischen Verfolgungs- und Gewaltgeschichte in Deutschland irgendwann einmal gelebte Normalität werden kann Darüber spricht die Historikerin Miriam Rürup in der neuen Folge des History & Politics Podcasts.
„… dieses Themenjahr bietet eine große Chance, die Vielfalt zu zeigen und auch die Vielfalt jenseits des Religiösen […] Und relativ viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Musiker und Musikerinnen, die heute gar nicht unbedingt für die jüdische Gemeinschaft stehen, sondern die auch anfangen beiläufig jüdisch zu sein. Und das ist ja die große Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht an den Punkt kommt, wo es gar nicht so besonders relevant ist, ob jemand jüdisch ist oder nicht, dass es quasi in die gleiche, im positiven Sinne jetzt, Bedeutungslosigkeit fällt wie, ob jemand evangelisch oder katholisch ist.“
Miriam Rürup, Historikerin
Hallo und herzlich willkommen! Dies ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zu Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir mit einem Gast über ein Thema, das Politik und Gesellschaft beschäftigt. Und fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Woidelko und freue mich, dass Sie bei uns reinhören.
Heute geht es um Entwicklung und Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland seit 1945. Unter welchen Bedingungen konnten Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg im Land der Täter ihr Leben [als Individuen und als Gemeinschaft] wieder aufbauen und wie hat sich das Zusammenleben zwischen ihnen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft seither verändert? Wie sehr ist jüdisches Leben heute in Deutschland durch Antisemitismus und rechte Hasskriminalität bedroht? Und welche Chancen gibt es, dass Jüdisch-Sein trotz der notwendigen Erinnerung an nationalsozialistischen Verfolgungs- und Gewaltgeschichte in Deutschland irgendwann einmal gelebte Normalität werden kann?
Darüber habe ich mit der Historikerin Miriam Rürup gesprochen. Miriam Rürup ist Expertin für deutsch-jüdische Geschichte und ist seit Dezember 2020 Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für Europäisch Jüdische Studien und Professorin an der Universität Potsdam. Vor ihrem Wechsel nach Potsdam war sie einige Jahre die Leiterin des Instituts für die Geschichte der Deutschen Juden in Hamburg.
Liebe Frau Rürup, Sie haben bis vor kurzem das Institut für die Geschichte der Deutschen Juden in Hamburg geleitet, bevor Sie nach Potsdam an das Moses Mendelssohn Zentrum und an die Universität Potsdam gegangen sind. Deshalb würde ich gerne mit zwei Hamburger Themen in unser Gespräch einsteigen: In Hamburg gibt es zwei sehr unterschiedliche Initiativen, die sich dem Erhalt und der Sichtbarmachung jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte in der Stadt widmen, einmal der Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge und dann die Erhaltung der Tempelruine in der Polstraße. Beide Initiativen haben über Hamburg hinaus Schlagzeilen gemacht. Ich würde Sie bitten, einmal kurz einzuordnen, was diese beiden Initiativen charakterisiert und was sie vielleicht auch unterscheidet.
Das ist in der Tat eine sehr schöne Einstiegsfrage, weil man an den beiden Initiativen schon aufzeigen kann oder sagen wir, nicht unbedingt an den Initiativen, sondern der damit verbundenen Aufmerksamkeit, die auf jüdisches Leben, auf jüdische Gegenwart auf innerjüdische und über die jüdische Gemeinschaft hinausgehende Diskurse verweist. Ich versuche einmal nicht zu weit auszuholen, aber um es ganz prägnant zusammenzufassen, stehen beide Orte für zwei Phasen in der jüdischen Geschichte Hamburgs, zwei Phasen, die in gewisser Weise auch sehr typisch für andere Städte sind, in denen es jüdische Minderheiten gab. Die Polstraße ist in der Hamburger Innenstadt gelegen, wo die frühe Altstadt und Neustadt war. Für diejenigen, die sich in Berlin besser auskennen, ist das das Viertel, wo Juden sich zuerst niederließen, wenn sie als Einwanderer kamen, als quasi noch nicht in der bürgerlichen Gesellschaft Angekommene. Dort stehen die Überreste des ersten Tempelbaus einer jüdischen Gemeinde, die sich als liberal verstanden hat. Das ist das große Novum im 19. Jahrhundert. Die andere Initiative befasst sich vor allen Dingen mit der Bornplatz-Synagoge, die einige Jahrzehnte später, nach der Jahrhundertwende, errichtet wurde. Sie wurde in einem Viertel erreichtet, in dem das jüdische Leben dann statt fand, nachdem die jüdische Minderheit in der deutschen bürgerlichen Gesellschaft vermehrt angekommen war, also das, was man gerne so als assimiliertes jüdisches Bürgertum sieht. Das sind also die zwei Orte. Einmal ein Ort, der an die Anfänge jüdischen Lebens in Deutschland erinnert, in dem Fall in Hamburg. Der andere Ort erinnert an die unmittelbare Vorkriegszeit, als jüdisches Leben sehr vielfältig war. Beide Orte sollen nicht nur bewahrt, sondern auch neu entwickelt werden, darum geht es in beiden Initiativen.
Beide Initiativen haben ja schon eine längere Vorgeschichte. Nicht erst seit gestern oder vorgestern, haben sich dort Menschen gefunden, die sich für den Erhalt oder den Wiederaufbau einsetzen. Beide Initiativen haben aber Ende letzten Jahres, also Ende 2020, deutlich an Schwung gewonnen, in dem Sinne, dass der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg sich zu dem Wiederaufbau und zu der Erhaltung bekannt und auch finanzieller Unterstützung zugesichert hat. Was denken Sie, welche Rolle spielt das jetzt laufende Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das wir derzeit begehen, für die Entscheidung beide Orte zu erhalten?
Was ich mir tatsächlich durch so ein Festjahr erhoffe, und was wir in den Entscheidungen auch schon sehen können, ist, dass es gewissermaßen wie ein Katalysator für die Aufmerksamkeit der ganzen Breite jüdischen Lebens und jüdischer Gegenwart agiert. Das wäre die positive Sicht darauf. Nun haben wir es da aber in beiden Fällen mit einem, ursprünglich zumindest, religiösen Ort zu tun. Und was die Initiative um den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge betrifft, ist das ja auch eine religiöse Initiative. Der große Unterschied zur Polstraße, den ich sehe und den ich mir auch vom Themenjahr erhoffe, ist, dass man erkennt, dass Judentum in Deutschland auch heute mehr ist als Religion und mehr ist als gemeindliche Zugehörigkeit. Die heutige Ruine in der Polstraße steht jetzt nicht mehr für eine existierende Gemeinde und für einen religiösen Ort, sondern für Emanzipation und Reform, für ein jüdisches Selbstverständnis in einer säkularen Umwelt, das sich gewissermaßen auch selbst verweltlicht. Insofern erhoffe ich mir, dass das Themenjahr dazu beiträgt, dass alles sich weiter öffnet, weg von den religiösen Orten. Nicht, um Religion in eine Nische zu verbannen, sondern um zu zeigen, jüdisches Leben ist wesentlich mehr. Es besteht aus so vielen Facetten, dass man sich von den Klischees, die häufig dann doch die Bebilderung jüdischen Lebens begleiten, ein wenig verabschieden muss.
Ja, das ist interessant. Sie haben jetzt eben schon zu meiner nächsten Frage übergeleitet. Ich habe herausgehört, dass Sie das Gefühl haben, dass gerade dieser Aspekt der Vielfalt manchmal in der öffentlichen Debatte in Deutschland ein bisschen zu kurz kommt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, genau. Das eine ist die innerreligiöse Vielfalt. Ich erkenne immer wieder, dass über die verschiedenen Formen jüdisch zu leben, auch im religiösen Sinne, wenig bekannt ist. Dafür ist so ein Festjahr mit unglaublich vielen Veranstaltungen deutschlandweit eine große Chance. Es gibt Juden, die man als orthodoxe Juden bezeichnen würde. Innerhalb der orthodoxen Juden gibt es auch unterschiedlichste Ausprägungen. Dann gibt es Juden, die eher messianischen oder gar leicht sektiererischen Strömungen anhängen. Es gibt die Juden, die sich als Liberale bezeichnen. Auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt es also verschiedene Gemeinden. Es gibt aber auch diejenigen, die sich als Juden bezeichnen und in irgendeiner Weise jüdisch leben, ohne Mitglied einer Gemeinde zu sein, die es eher als eine kulturelle Prägung sehen. Und dann gibt es diejenigen, die sich eher aus der Geschichtsgemeinschaft der jüdischen Geschichte als Juden begreifen und definieren. Diese Ausprägungen sind in der Mehrheitsgesellschaft gar nicht so bekannt, sollten aber mehr Aufmerksamkeit bekommen. So ein Festjahr ist eine große Chance, auch um das deutsch-jüdische und das deutsch-nichtjüdische Verhältnis zu mehr Vielfalt zu verhelfen und es auszudifferenzieren.
Nun gibt es im Umgang mit jüdischem Leben und jüdischer Geschichte in Deutschland durch den Zivilisationsbruch der Shoa und durch die NS-Verfolgungsgeschichte eine ganz klare Zäsur. Es gibt sozusagen die jüdische Geschichte und das jüdische Leben vor 1939/1945 und dann gibt es die Phase danach. Worüber sprechen wir denn, wenn wir über jüdisches Leben und jüdische Geschichte in Deutschland heute, im Jahr 2021 sprechen? Welche Zäsur gibt es, wenn wir die Phase von 45 bis heute in den Blick nehmen?
Die Frage sind wir mitten in der Klärung, auch untersuchen wir, warum die jüdische Gegenwart heute so ist wie sie ist. Die unbekannte Vielfalt, die ich gerade beschrieben hatte, liegt nicht an der Mehrheitsgesellschaft, sondern es liegt letztlich daran, dass die Nationalsozialisten jüdisches Leben in Deutschland weitgehend zerstört haben und es nach dem Krieg äußert mühselig wieder aufgebaut werden musste. Jüdische Gemeinschaft war so klein, dass es quasi an jedem Ort, an dem es Juden gab, höchstens eine Gemeinde gab und diese Gemeinden dann auch so klein waren, dass es Schwierigkeiten gab, genügend Menschen für einen Gottesdienst zusammenzubekommen. Dass es die heutige Vielfalt und Auffächerung gibt, ist etwas ganz modernes und ein Ergebnis der letzten Zäsur, zu der wir gleich kommen werden. Wenn wir von der Gegenwart jetzt ein wenig zurück gehen, gab es nach 45 nur eine verschwindend kleine Zahl an jüdischen Gemeinschaften. Zwischen 10.000 bis 15.000 Überlebende und Zurückgekehrte aus dem Exil zählten dann im gesamten Territorium Deutschland zur jüdischen Gemeinschaft. Dazu kamen noch die Displaced Persons, das waren die Juden und Jüdinnen mit osteuropäischem Hintergrund, die sich nach dem Krieg als Vertriebene in Deutschland wiederfanden und zunächst in den Displaced Persons Lagern lebten, teilweise aber auch in Deutschland blieben. Das ist gewissermaßen der Kern, aus dem sich die frühe jüdische Gemeinschaft nach 45 zusammengefunden hat. In Westdeutschlandweit waren das zwischen 20-25.000, also ein wirklich verschwindend geringer Bruchteil der Bevölkerung. Und was noch dazu kam ist, dass diese erste Phase auch von einer extremen Überalterung der Gemeinden geprägt war. Durch die vielen Rückkehrer und die Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos fehlte es an Jugend und damit auch an Aussicht, wie die Zukunft für die jüdische Gemeinschaft aussehen wird. Diese erste Phase ist also zum einen geprägt davon, dass man einfach in irgendeiner Weise wieder ankommen möchte, zurück in ein Leben finden möchte und zum anderen davon, dass es gewissermaßen nicht nur unausgesprochen, sondern sogar auch ausgesprochen die Maßgabe gab, jüdisches Leben in Deutschland soll nie wieder entstehen. Das war in dem Fall eine Maßgabe, die von der jüdischen Gemeinschaft außerhalb Deutschlands geäußert wurde, stark geprägt durch eine zionistische Sicht. Zum einen wollte man natürlich, dass Juden und Jüdinnen in den Jischuv, also in die jüdische Ansiedlung nach Palästina und ab 1948 dann nach Israel einwandern, zum anderen weil man wirklich davon ausging, im Land der Täter hat jüdisches Leben nichts mehr verloren. Das war auch die Maßgabe, die der jüdische Weltkongress verlautbarte. Unter diesem Etikett, des eigentlich nicht akzeptablen jüdischen Lebens, neues jüdisches Leben zu entwickeln, war durchaus eine Belastung, die man auch an der Art des Gemeindelebens merkt. Das war ein sehr zurückgezogenes Gemeindeleben, nicht besonders öffentlich. Die ersten Synagogen, die gebaut wurden, waren unauffällig, wenn überhaupt in diesen frühen ersten zehn bis zwanzig Jahren, welche gebaut wurden.
Wann würden Sie sagen, endet diese Phase? Was änderte sich in den 60er Jahren, nachdem in den ersten zehn bis zwanzig Jahren, wo das jüdische Leben aus Gründen, die Sie eben beschrieben haben, unter dem Radar oder eher zurückgezogen ablief?
Ja genau. Das ändert sich in den 60ern. Da kann man beobachten, dass in Städten wie beispielsweise Hamburg, aber auch Hannover, Karlsruhe und auch Frankfurt teilweise Neubauten errichtet werden, die zwar sehr funktional sind, die aber zeigen, da entsteht eine Gemeinschaft, die nicht nur vorübergehend da ist. Die Idee des transitorischen wird hier hinter sich gelassen, man würde sonst kein Haus bauen. Der damalige Hamburger Bürgermeister, Max Brauer, hat zur Einweihung der Synagoge an der Hohen Weide in Hamburg in Eimsbüttel gesagt, wer ein Haus baue wolle bleiben. Das wurde später noch einmal aufgegriffen und eigentlich wesentlich berühmter, als Salomon Korn etwas 20 Jahre später beim Bau des Gemeindezentrums in Frankfurt diesen Satz wiederholte. Damit sind wir auch quasi bei der nächsten Zäsur. In den 60ern fängt das an mit zaghaften Neubauten, die eben signalisieren: Wir bleiben. Damit kommt auch eine neue Generation langsam zu Wort, eine neue in Deutschland aufgewachsene Generation, die den zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, aber deren Eltern eben diese schwere Last ihnen gewissermaßen weitervererbt haben. Und diese neue Generation von Juden und Jüdinnen belebt dann eben dieses Gemeindeleben, was in den 60ern entsteht. Und man merkt auch allmählich eine kulturelle Wahrnehmung von jüdischem Leben. Aber die nächste große und eigentlich wichtigere Zäsur ist so Anfang der 80er Jahre ungefähr, als man merkt, es gibt auch in der nicht-jüdischen deutschen Bevölkerung eine zunehmende Aufmerksamkeit für der Geschichte der jüdischen Minderheit. Es gibt sozusagen eine Aufmerksamkeit für der Geschichte der jüdischen Minderheit, die aber immer vom NS her gedacht wird, also von der eigenen Schuld der Eltern, die man überwinden möchte, indem man sich dem Jüdischen quasi zuwendet.
Würden Sie sagen, dass das auch mit der Fernsehserie »Holocaust« zu tun hat, die damals gezeigt wurde? An vielen Stellen gibt es ja diese Überlegung, dass die Fernsehserie, damals den Deutschen das vor Augen geführt hat, was sie eigentlich bis dato nicht hatten sehen wollen, nämlich die Geschichte des NS und der Verfolgung von Jüdinnen und Juden und anderer Minderheiten im Alltag. Also die Thematisierung des Mitmachens und der Beteiligung der deutschen Zivilbevölkerung an den Verfolgungen. Würden Sie sagen, dass das auch mit Blick auf die Wahrnehmung jüdischen Lebens eine Zäsur für die deutsche Mehrheitsbevölkerung war?
Unbedingt. Und zwar nicht nur im Umgang mit der eigenen Schuld. Dafür ist die Serie ja wirklich höchst faszinierend. Ich kann es nur jedem empfehlen, diese auch heute noch mal anzuschauen. Auch Jahrzehnte später hat die nichts an ihrer Kraft verloren, würde ich sagen, weil sie einen alltäglichen Blick auf das Geschehen wirft. Und damit bringt sie das schwierige deutsch-jüdische Verhältnis aus den Feuilletons und aus den Gerichtssälen, in denen NS-Prozesse verhandelt wurden, in die Wohnzimmer. Und in den Wohnzimmern, wo der Alltag stattfindet, lernt man plötzlich »ganz normale Juden« kennen. Genauso wie man ganz normale deutsche Täter kennenlernt in der Serie, lernt man auch die ganz normalen Juden kennen. Und das ist so eine erste Begegnung, die es wahrscheinlich auch verstärkt hat, dass man beginnt nach jüdischer Geschichte zu fragen und feststellt, dass es kaum etwas gibt, wohin man sich mit seinen Fragen richten kann. Nach 79, nachdem diese Serie ausgestrahlt wurde, gibt es tatsächlich einen Schwung, nicht nur in der Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der deutschen Gesellschaft überhaupt, sondern auch einen Schwung an jüdischen Museen, die entstehen. Man merkt, es gibt eine Hinwendung zur jüdischen Geschichte, um sich die Gegenwart zu erklären. Natürlich geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse, aber es geht auch darum, aus diesen historischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen das jüdische und nicht-jüdische Miteinander in der Gegenwart zu vereinfachen und zu erklären. Und so entstehen ersten Museen und Ausstellungen in ehemaligen Synagogen. Teilweise an Orten, wo es zu dem Zeitpunkt meines Wissens nach gar keine jüdische Gemeinde gibt, Worms ist eines dieser Beispiele. Vielleicht gibt es dort vereinzelte Juden in der Stadt, aber keine eigene jüdische Gemeinde. Auch an viel kleineren Orten, wie in Jever in Ostfriesland, also im regionalen Bereich, gibt es so einen Aufschwung an Interesse am Jüdischen.
Ich denke, dass das auch ein bisschen eine Selbstvergewisserung oder eine Positionierung, der deutschen Gesellschaft damals war, um noch einmal zu verstehen und besser hinzugucken in die Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens, wo es sie dann noch gab; um vielleicht auch irgendetwas aufzuholen?
Unbedingt. Um etwas aufzuholen und vielleicht auch zu verstehen. Aber auch mit einem starken Drang nach Versöhnung, würde ich sagen. Es ist noch ein bisschen untererforscht, was die Rolle und Ausprägung des Philosemitismus in der deutschen Bevölkerung betrifft, dieses quasi Gegenstücks des Antisemitismus, der ja einfach wörtlich übersetzt »Liebe zum Judentum« bedeutet und häufig aus einer christlichen, religiösen, kirchlichen Prägung heraus entsteht. Es ist wie, als würde man umdrehen, wie vorher mit einem kirchlichen missionarischen Eifer, schon fast wie eine obsessive Beachtung alles jüdische wahrgenommen wurde, und daraus eine Versöhnungsgeste machen. Das sind dann auch die frühen Aufschwünge von dem, was wir ja leider heute immer noch haben, dass das Jüdische gerne mit Klezmer Musik verbunden wird.
Folklore.
Genau. Es ist eine von der Motivation her völlig nachvollziehbare und sehr sympathische, finde ich, Auseinandersetzung mit dem Jüdischen, dass man tatsächlich schaut, was es denn innerhalb der jüdischen Minderheit an Besonderheiten gibt. Dann guckt man zum Beispiel in die Musik und greift dann aber ausgerechnet Klezmer heraus, was eine osteuropäische Musikvariante ist. Es ist natürlich auch ganz interessant zu sehen, welche Aspekte als vermeintlich typisch jüdisch wahrgenommen werden. Ich möchte das jetzt gar nicht abfällig sagen, sondern wirklich nur mit dem Hinweis darauf, dass es in den 80ern eine Wende hin zu einer Aufmerksamkeit jüdischer Kultur und jüdischer Gegenwart gab.
Ich denke, dass sich der Blick auf die jüdische Kultur, die jüdische Geschichte und das jüdische Leben in Deutschland in den letzten 20 bis 30 Jahren noch mal deutlich verändert hat, oder wie würden Sie das einordnen?
Das ist dann quasi die nächste Zäsur, die gleich nach dieser Wende Anfang der 80er, also nach der Holocaust-Serie, zu einer neuen Veränderung des jüdischen Lebens und der jüdischen Minderheit führt. Und mit dieser Veränderung sind wir dann tatsächlich bei dem Punkt angelangt, wo wir näher an die Gegenwart kommen, wo diese kleine jüdische Minderheit – ich hatte vorhin von 15.000 bis 20.000 direkt nach dem Krieg gesprochen – dann in den 80ern etwa einer Zahl von 25.000 bis 30.000 bundesrepublikweit entsprach. Dann kam die Wende und es kam die jüdische Gemeinschaft aus der DDR dazu, die aber eher relativ klein war. Es kamen aber auch die sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion. Und deren großer Zahl, teilweise bis zu 100.000, sind dann in den Gemeinden verblieben sind. Mit diesen Zuwanderinnen und Zuwanderern entstanden teilweise sogar ganz neue Gemeinden, die dann teilweise in Gänze ex-sowjetisch oder russisch geprägt waren. Und auch das ist wieder eine kulturelle Prägung, die die jüdischen Gemeinden bis heute spüren. Es handelt sich um Juden und Jüdinnen mit einem anderen Verständnis ihres Judentums, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die zur Wiederbelebung der jüdischen Gemeinden in Deutschland beigetragen haben. Und sie haben nicht nur zu einer numerischen Wiederbelebung geführt, sondern eben auch eine kulturelle Veränderung herbeigeführt. Was mit diesen Zuwanderern dann auch passiert, und damit sind wir sozusagen in der letzten Phase, die auch noch anhält, ist eine Verjüngung. Denn es sind auch Jugendlichen und Kinder mitgekommen. In den 90ern und frühen 2000ern wurden neue Kinder geboren die jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene sind, die die heutige jüdische Gemeinschaft sehr wortstark auch nach außen vertreten.
Tatsächlich wollte ich Sie das gerade fragen. Es gibt ja sehr prominente Vertreterinnen und Vertreter dieser Generation. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, darunter welche, die wie Sie sagen, sehr wortgewaltig und wortgewandt, auch im Vergleich zu den 80ern und der Zeit davor, mit einem neuen Selbstbewusstsein ihr Jüdischsein und das Anliegen jüdischer Menschen in Deutschland vertreten.
Ja, aber das ist ganz wunderbar. Da sind wir wieder an dem Punkt vom Anfang, als ich sagte, dass dieses Themenjahr eine große Chance bietet, die Vielfalt zu zeigen und auch die Vielfalt jenseits des Religiösen; zu sehen, dass Gemeinden zwar zunächst der Ausgangspunkt dieser Vielfalt sind, aber dann ganz viel anderes entsteht. Und es entstehen neue Zeitschriften wie »Jalta«, eine Zeitschrift, die es jetzt, glaube ich, im zehnten Jahr gibt. Sie wird genau von dieser Generation betrieben. Es gibt viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Musiker und Musikerinnen, die heute gar nicht unbedingt für die jüdische Gemeinschaft stehen, sondern die auch anfangen beiläufig jüdisch zu sein. Und das ist ja die große Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht an den Punkt kommt, wo es gar nicht so besonders relevant ist, ob jemand jüdisch ist oder nicht, dass es quasi in die gleiche, im positiven Sinne jetzt, Bedeutungslosigkeit fällt wie, ob jemand evangelisch oder katholisch ist. Das ist allerdings auch eine Hoffnung, die ich mit den Zeitgenossen von vor hundert Jahren oder sogar von vor 130 Jahren teile. Als im Kaiserreich der Zentralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens gegründet wurde, als größte Massenorganisation der jüdischen Minderheit, gab es die Hoffnung, das allein zeigt ja schon der Name, dass man da schon angekommen sei an dem Punkt, wo Religion nur eine Individualsache ist und zuvorderst die Organisation und der Staat steht. Das wurde dann 33 ins Gegenteil verkehrt, aber heute kann man hoffen, dass tatsächlich so ein staatsbürgerliches Verständnis vielleicht an erster Stelle stehen könnte.
Das wäre ein Wunsch und eine Hoffnung. Dafür haben wir aber noch eine kleine Strecke zurückzulegen und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wie sehr sich das mit der Erinnerungskultur, mit den Debatten, die wir hier in Deutschland führen und ja auch weiterhin über die Shoa und über den Zivilisationsbruch führen müssen, vereinbaren lässt. Ich verstehe den Wunsch, aber ich glaube, dass es noch auf längere Zeit etwas Besonderes sein wird, wenn wir in Deutschland über Judentum und jüdisches Leben sprechen und nachdenken.
Das stimmt, aber das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Vielleicht muss ich das nochmal präzisieren. Es geht darum, dass Juden als Juden nicht unbedingt immer nur über das deutsch-jüdische Verhältnis sprechen müssen, sondern dass man den Punkt erreichen kann, wo es nicht immer nur die Juden und Jüdinnen sein müssen, die darüber immer sprechen, sondern, dass es die nicht-jüdische oder Gesamtgesellschaft tut. Selbstverständlich wird die deutsch-jüdische Geschichte immer von diesem Bruch gekennzeichnet sein, auch noch in 20, 30, 40 Generationen, dennoch ist mein Punkt, dass der Jude von nebenan auch einfach nur Koch sein kann und nicht auf einem Podium darüber Auskunft geben muss, wie es ist mit jüdischer Identität Koch zu sein.
Das ist ein ganz wunderbares Bild, Frau Rürup. Das ist, glaube ich, noch einmal wichtig, dass Sie das an dieser Stelle präzisieren. Wenn wir in Deutschland über jüdisches Leben und jüdische Kultur und jüdische Geschichte sprechen, dann sollten wir auch, und das sollten wir auch in unserem Gespräch tun, über das Thema Antisemitismus sprechen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, in dem wir über den Zivilisationsbruch, über die Jahre 33-45 gesprochen haben. Es gibt ja seit einigen Jahren den Antisemitismusbericht, der in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird, meines Wissens das letzte Mal 2016. Immer wieder wird dort deutlich, dass die größte Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland von rechter Hasskriminalität ausgeht. Es gab eine Reihe von antisemitischen Straftaten in den letzten Jahren, wie das Attentat auf die Synagoge in Halle, aber auch in Hamburg haben wir das Attentat auf den jüdischen Studenten vor der Synagoge gesehen. Zwei Dinge bewegen mich dabei, nämlich einmal die Frage, ob wir es eigentlich mit einem wachsenden Problem zu tun haben und, wie ihr Blick auf die Diskussion um die sogenannten Einzeltäter in diesem Zusammenhang mit solchen Straftaten ist. Also wie weit kommen wir mit dieser Argumentation der Einzeltäter und haben wir es nicht doch mit einem Phänomen zu tun, dem wir uns als Gesellschaft und auch vielleicht in der Politik doch dezidierter widmen müssen?
Die These vom Einzeltäter ist tatsächlich etwas, was mir auch regelmäßig Bauchschmerzen bereitet. Die wird ja gerade dann, wenn es sich um rechtsextreme Anschläge handelt, schnell und für eine ganze Weile versucht aufrechtzuerhalten. Der Einzeltäter, der psychische Probleme gehabt hat, der zurückgezogen gelebt habe und ähnliches. Das sind ja Muster, die sich tatsächlich wiederholen. Das war beim Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München von vor drei oder vier Jahren so. Und das war in dem Fall, den Sie gerade genannt haben, mit Hamburg auch so und das ist jetzt sogar auch vor Gericht noch mal bestätigt worden. Das Interessante für mich dabei ist, dass es tatsächlich wie ein Abwehrreflex zu sein scheint. Gleichzeitig muss man sich fragen, wenn es sich wie bei dem Hamburger Fall, um einen psychisch gestörten Menschen und einen dadurch durchaus auch bemitleidenswerten Menschen handelt, wie er darauf kommt genau dort seine Störung auf diese Weise auszuleben? Und damit ist es dann doch ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Antisemitismus. Denn er erfindet es ja nicht. Er guckt sich das irgendwo ab und er folgt einem Schema, das einem Schema andernorts, beispielsweise in Halle, ähnelt. Ich frage mich auch regelmäßig, ob wir von einem steigenden Antisemitismus sprechen müssen oder, ob die Zahlen nicht vielleicht darauf hindeuten, dass die Gesellschaft zunehmend ihre Aufmerksamkeit auf Antisemitismus lenkt. Es wäre eine insofern erfreuliche Entwicklung, als dass das Bewusstsein geschärft ist dafür, dass Antisemitismus als Antisemitismus benannt wird. Auch die vermehrte Anzahl an Monitoring-Einrichtungen, wie die Rias, also die Recherchestelle gegen Antisemitismus, ist ein Zeichen dafür, die hat ja sogar bundesweit Organisationen. Also, dass es auch zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die Antisemitismus ganz genau beobachten und analysieren und den Blick darauf richten und die Betroffenen, die zunehmend die Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen. Wir haben aber ein massives Problem in der Gesellschaft, das ist fraglos der Fall. Da können wir uns auch nicht rausreden, dass nach 45 der Antisemitismus noch im hohen zweistelligen Bereich war, weil das noch die NS-durchtränkte Gesellschaft war. Das Problem allerdings, was wir heute sehen, ganz verkürzt vielleicht, ist, dass es gerade jetzt aktuell bei den Corona-Protesten, sagen wir, antisemitische Querfrontstrategie zu sehen gibt. Und das ist etwas, wo ich durchaus denke, da steht uns noch einiges bevor, wo wir aufklären müssen.
Würden Sie sagen, dass durch die Corona-Protestbewegung die antisemitischen Stereotype, die Sie eben genannt haben, auch in gewisser Weise wieder salonfähig werden? Weil es diese Querfront gibt, weil es viel Aufmerksamkeit dafür gibt, weil darüber viel diskutiert wird, sind sozusagen die Grenzen des Sagbaren dann auch damit überschritten oder weiter ausgedehnt?
Ganz unbedingt. Dieses Sammelbecken der Esoteriker, Reichsbürger, eingeschworenen Nazis, der noch leicht verirrten »Corona-Leugner«. oder auch ohne Anführungszeichen, führt dazu, dass diejenigen, die bislang vielleicht nur für sich selbst im Internet oder sich in ihrem engsten Freundeskreis gegenseitig bestätigt haben, nun eine wesentlich größere Plattform sehen. Und Salonfähigkeit ist dafür genau der richtige Begriff. Wenn man merkt, welche Dinge auf einem Massenprotest, bei dem 10.000 sind, gesagt werden, die man sich bislang nur getraut hat in seinem engsten Freundeskreis zu äußern, ist das eine unglaubliche Erfahrung der Selbstbestärkung und Bestärkung von außen und die kann dann wieder etwas dynamisieren, was wir als Gesamtgesellschaft mühselig wieder einfangen müssen. Man kann vielleicht ein bisschen hoffen, dass es ein Teil einer Krisenerscheinung ist. Nichtsdestotrotz muss man sich sagen, dass auch das in der jüdischen Geschichte ein wiederkehrendes Motiv ist. Denn bei der Cholera-Epidemie im 19. Jahrhundert und bei der Pest im Mittelalter gab es schnell ähnliche Muster der Verschwörungstheorien - der Ideen, weil man eigentlich noch nicht mal von einer Theorie sprechen sollte, weil es schon zu wissenschaftlich klingt; also der Verschwörungsmythen - die sagten, Juden hätten im Mittelalter die Brunnen vergiftet und am Ende des 19. Jahrhunderts bei der Cholera-Epidemie hieß es, Juden würden von der Epidemie profitieren, weil sie als Mediziner vom Verkauf von Medizin profitieren. Heute haben wir dann genauso krude Verschwörungsszenarien. Das schlimme ist aber, dass diese über das Internet eine unglaubliche Verbreitung findet und eben auf diesen großen Demonstrationen auch eine vermeintliche gesellschaftliche Breite erfährt.
Was können wir denn als Gesellschaft tun, um gegen diese antisemitischen Verschwörungstheorien, um gegen latenten Antisemitismus vorzugehen? Denn es ist ja nicht so, dass es keinerlei Bildungs- und Aufklärungsarbeit gäbe, ganz im Gegenteil, es gibt ja schon sehr viel. Was können wir denn vielleicht noch anders machen?
Auch wenn es schon unglaublich viel Bildungs- und Aufklärungsarbeit gibt, ist das dann trotzdem immer noch das erste, wo ich sagen würde, da muss man weiter dran bleiben. Denn zur Aufklärungsarbeit gehört auch dazu, dass man positive Angebote macht. Wenn wir uns schulische Bildung zu jüdischer Geschichte anschauen, dann ist es auch heute noch durchaus verbreitet, dass die Erfahrung, die man über jüdisches Leben macht, verbunden ist mit Verfolgung und Opferstatus. Das heißt, es gibt wenig positive Beispiele. Und mit positiven Beispielen meine ich jetzt nicht, dass man erfährt, es gab den großen Aufklärer Moses Mendelssohn oder es gab Albert Einstein, sondern positive Beispiele im Sinne von, den ganz normalen Juden. Juden sind ganz genau so normale Menschen wie alle Nichtjuden auch. Diese positiven Beispiele sollten verstärkt werden. Und das würde dann sowohl für Aufklärung und Wissensvermittlung gelten, als auch für das emotionale, was man ja auch nicht außen vor lassen darf. Also Hass ist eine Emotion und genauso muss die Antwort und der Versuch der Gegenwehr zu Hass auch emotionale Glaubwürdigkeit mit sich bringen. Und die erreicht man am ehesten, indem es Beispiele gibt, die positive Vorbilder, jüdische Vorbilder oder Vorbilder von jüdisch-nicht jüdischer Gemeinsamkeit, die positiv gelebt wird, zeigt. Es gibt das eine Beispiel dieser Initiative »Meet a Jew« oder »Rent a Jew«. Es gab am Anfang des 2000er im Jüdischen Museum in Berlin bei einer Ausstellung den Juden im Glaskasten, den man fragen konnte, was man wollte. Das war eine ganz neckische Idee, weil es eine gewisse Leichtigkeit reinbringt und eben mal erlaubt, auch über anderes zu sprechen als über Verfolgung und Schuld. Nichtsdestotrotz darf man auch nicht aufhören darüber zu sprechen. Das wäre ja auch noch so ein Aspekt, auf den wir eingehen könnten. Die Frage des Umgangs mit Erinnerungen und Verantwortung für die NS-Vergangenheit.
Das stimmt tatsächlich, ja. Die Fragen: Wie wird erinnert und woran wird erinnert und warum eigentlich? Da haben Sie jetzt eben schon ein bisschen anmoderiert. Tatsächlich finde ich diesen Gedanken ganz interessant, neben der Bildungsarbeit und der Aufklärungsarbeit über NS-Verfolgungsgeschichte auch Angebote zu machen, die sich beschäftigen mit dem Zusammenleben von Nichtjüdinnen und Nichtjuden und Jüdinnen und Juden in Deutschland, mit sozusagen kulturellen Fragen. Gibt es auch noch andere Orte neben dem Jüdischen Museum in Berlin, welches Sie gerade erwähnt hatten, an denen in diese Richtung gedacht und gearbeitet wird? Wo, würden Sie denn sagen, hat da in den letzten Jahren wirklich etwas stattgefunden, was auch wegweisend sein kann?
Wegweisend, finde ich alles, was nicht dem klassischen Kanon entspricht, was nicht die großen Gedenktage sind, was nicht das Modul im schulischen Unterricht ist, wo es um Juden geht, sondern das was beiläufig und zufällig passiert. Beispielsweise Filmfestivals, bei denen man, weil man ins Kino gehen möchte, etwas über jüdisches Leben erfährt. Ähnlich wie Theater, Musik. Literatur. So was, würde ich sagen, sind Beispiele, ich weiß nicht, ob ich sie gleich wegweisend nennen würde, aber wo man merkt, es hat was von einem unbeschwerten Vermittlungscharakter jüdischer Existenz und Identität, der durchaus auch voranbringen kann.
Das bringt uns zum Anfang unseres Gesprächs zurück, wo wir ja schon kurz über das Themenjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gesprochen haben. In gewisser Weise könnte ja auch so ein Angebot wie das Themenjahr ein bisschen in diese Richtung weisen, weil die Idee des Themenjahres ja genau die ist, dass wir eben nicht nur reduziert durch die Verfolgungsgeschichte und die Shoa das jüdische Leben und die jüdische Kultur in Deutschland betrachten, sondern ein bisschen die größeren Linien ziehen und auch das selbstverständlichere mit in den Blick nehmen, Dinge, die bisher gar nicht so sehr auf dem Radar waren. Also Stichwort die Polstraße in Hamburg, das liberale Judentum, ein gewisses sozusagen liberales, kulturelles, jüdisches Erbe. Das Themenjahr könnte ja auch da eine Chance sein, oder?
Das ist meine große Hoffnung, die ich mit dem Themenjahr verbinde. Auch wenn ich kleine, doch auch spitze Bemerkungen zu dem Themenjahr machen möchte: Diese 1700 Jahre als Etikett suggerieren ja, es hätte ein deutsch-jüdisches Miteinander seit 1700 Jahren gegeben. Insofern sehe ich die Aufgabe in diesem Jahr auch darin zu zeigen: So war es nicht, und zwar nicht einfach wegen der zwölf Jahre 33-45, sondern überhaupt deshalb, weil es nicht seit 1700 Jahren ein deutsch-jüdisches Miteinander gab. Es gab dieses Edikt 321, dass Juden sozusagen erstmals städtische Privilegien oder Möglichkeiten bot, die sie vorher nicht hatten, aber es folgten Ausweisungen und es folgte eben kein Niederlassungsrecht. Bis das Wahlrecht erreicht war, vergingen ohnehin noch Jahrhunderte. Aber wir sprechen ja eher von ganz alltäglichen Dingen, wie das Niederlassungsrecht, Eherecht und ähnliches. Es war also noch lange nicht von einem Miteinander zu sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es uns natürlich die Chance, dass wir einfach mal breiter schauen, und zwar sowohl in der Zeitleiste breiter und uns auch einmal jenseits des 20. Jahrhunderts anschauen, was es an jüdischem Leben gegeben hat, als auch in die verschiedenen Facetten. Ein bisschen möchte ich aber auch davor warnen, dass wir da doch wieder in diesen versöhnlichen Ansatz reingeraten, dass wir an sich schon immer gemeinsam gelebt haben, nur leider durch ein paar Zäsuren und Probleme unterbrochen wurden. Dieser Gefahr müsste man entgegenwirken. Das erinnert mich an ein Schlagwort, was seit etwa fünf bis sechs Jahren zu beobachten ist. Das »christlich-jüdische Abendland« ist eine ähnliche Fantasie, bei der ich mich immer frage, woher diese Fantasie kommt, wenn nicht für die Abwehr dessen, was man nicht zulassen möchte? Ganz konkret, glaube ich, ist das Schlagwort des christlich-jüdischen Abendlandes, mit der Flüchtlingswelle aus Syrien immer stärker geworden und da kann ich nicht anders als so eine gewisse Abwehrhaltung sehen, die die jüdische Minderheit vereinnahmt und damit versucht, die Geschichte zu beschönigen. Und davor müssen wir uns hüten. Aber das soll nicht heißen, dass ich mich nicht darauf freue, genau dieses Themenjahr jetzt zu begehen, um eben zu zeigen, die deutsch-jüdische Geschichte ist unglaublich vielfältig, genau wie die deutsch-jüdische Gegenwart vielfältig ist.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal einen Blick werfen auf das, was Sie jetzt gerade umtreibt oder zukünftig umtreiben wird, als Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam. Sie unterrichten, forschen und vermitteln dort jüdische Geschichte vor allen Dingen im europäischen oder transnationalen Kontext. In einem Interview haben Sie mal gesagt, die Geschichte des Judentums lässt sich eigentlich gar nicht verstehen, wenn man sie nicht international einbettet. Und mich würde interessieren, welche Chancen Sie gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass auch die Gesellschaft hier bei uns in Deutschland und in Europa insgesamt diverser wird, sehen? Welche Chancen sehen Sie in diesem transnationalen, ja internationalen Ansatz und Blick auf jüdische Geschichte?
Man könnte sagen, dass das die positive Antwort auf eine historische Erfahrung durch jüdische Minderheit ist. Die jüdischen Minderheiten waren ja allein schon durch regelmäßige Vertreibungen aus den Orten, in denen sie lebten, durch Pogrome und ähnliches, immer auch geprägt von Migration und eben nicht immer freiwilligen Migrationsbewegungen. Das heißt, wenn wir jetzt aber von transnationaler Existenz und Gegenwart sprechen und der daraus folgenden Vielfalt, dann ist das quasi die positive Wendung dieser historischen Erfahrungen der jüdischen Geschichte und damit ist es etwas höchst Erfreuliches. Wir haben über die verschiedenen Zäsuren nach 45 in der deutsch-jüdischen Geschichte gesprochen und wir könnten sagen, wir befinden uns jetzt sogar in einer Phase, die die Zuwanderung der Kontingentflüchtlinge überschreitet. Nämlich sind wir das erste Land, aus dem Juden auch wieder auswandern, und zwar nicht nur, weil der Antisemitismus steigt, sondern weil sie in andere Länder ziehen wollen; weil sie weiterziehen wollen, andere Länder erfahren wollen, wie Israel oder die USA. Und wir sind ein Land, in das Israelis einwandern. Das heißt, eine neue säkulare jüdische Identität, die hauptsächlich israelisch ist und sich damit gar nicht unbedingt in erster Linie als jüdisch, schon gar nicht als religiös, definiert. Diese zählt inzwischen sehr stark zur hiesigen Minderheit. Und diese Minderheit wiederum kommt nicht unbedingt nach Deutschland, um für immer und ewig zu bleiben. Das heißt, sie bringt mit sich einen wesentlich internationaleren, im positiven Sinne jetzt, Blick. Dass wir letztlich ein Teil Europas sind, dass wir ein Land sind, in das man migrieren und aus dem man auch wieder emigrieren kann, hat natürlich auch Auswirkungen auf den antisemitischen Verschwörungsmythos. Zu ihm passt die universelle Identität des Juden und der Jüdin, die sozusagen kein festes Territorium und keinen Boden hat. Ein Luftmensch wäre so ein Topos, der damit verbunden war. Aber die heutigen jüdischen Luftmenschen sind quasi die modernen Europäer, oder vielleicht auch einfach die modernen Weltbürger. Wenn wir uns den Twitter-Account von Igor Levit anschauen, dann sehen wir da erstens jemanden, der in erster Linie Musiker ist, in zweiter Linie einen politisch denkenden und handelnden Menschen und in dritter Linie nennt er sich Weltbürger. Und dieses Grundverständnis ist, glaube ich, etwas, was sehr viele der jungen jüdischen Minderheit der heutigen deutschen Gesellschaft mitbringen und was sie ausmacht.
Und diesem Selbstverständnis der modernen Jüdinnen und Juden, die entweder bei uns in Deutschland jetzt schon leben oder die zu uns kommen und dann auch wieder auswandern, das können Sie sozusagen spiegeln mit Ihrer Herangehensweise an jüdische Geschichte. Also immer im internationalen Kontext, nicht reduzieren auf das eine, auf diese jüdische Identität oder die Identität als Jude/Jüdin in Deutschland, sondern sozusagen globaler denken und das globaler betrachten?
Genau, das globaler betrachten, auch seine eigene Existenz letztlich globaler betrachten. Und es findet sich auch historisch schon. Ich habe mal ein bisschen über jüdische Juristen in der Zwischenkriegszeit in Osteuropa gearbeitet und da habe ich einen kleinen Aufsatz geschrieben, über diejenigen, die sich in der Zwischenkriegszeit mit Minderheitenrecht in Europa befassten und als Juden ab 33 emigrierten, weil sie sehen was sich anbahnt. Die ließen sich dann in den USA und in England nieder, um dort vor allen Dingen sich im Völkerrecht aktiv einzubringen. Man merkt, dass aus der jüdischen Erfahrung der Verfolgung, des eben nicht vorhandenen ausreichenden Minderheitenschutzes, eine universelle Antwort, oder zumindest der Versuch einer universellen Antwort entsteht. Wenn man als Jurist sagt »gut ich beschäftige mich eben gerade nicht mit nationalem Recht, sondern mit Völkerrecht, um die Gesellschaft vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen«, dann ist das jetzt mit ein bisschen Pathos gesprochen, aber eben auch ein universeller Ansatz. Das ist was, was man eben auch historisch in der jüdischen Minderheit beobachten kann und was ich durchaus bei der jetzt jüngeren Generation der Juden und Jüdinnen in Deutschland teilweise beobachte im kulturellen Bereich.
Allerletzte Frage, Frau Rürup: Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, in die nächsten drei bis fünf oder zehn Jahre, welches Zeichen sollten wir in Deutschland als Gesellschaft setzen? Welches Zeichen sollten wir setzen, wenn es um das Bekenntnis dazu geht, dass jüdisches Leben, die jüdische Kultur und die jüdische Geschichte ein fester und, wie Sie es vorhin gesagt haben, auch selbstverständlicherer Bestandteil unseres Alltags und unseres Selbstverständnisses hier ist. Was können wir tun?
Die Frage an sich ist schon ein bisschen problematisch, weil es das eine Zeichen nicht gibt. Ich würde sogar eher sagen, man hat zu lange versucht ein Zeichen zu setzen. Man hat eine Gemeinde organisiert, man hat ein Mahnmal errichtet, man hat an einem Jahr am 9. November gedacht oder am Tag der Befreiung. Ich würde aber sagen, die Antwort auf die Vielfalt der jüdischen Gemeinschaft heute ist, eben viele Zeichen zu setzen. Und damit sind wir auch ein bisschen wieder am Anfang unseres Gesprächs. Nämlich, wenn wir uns anschauen, was gerade in Hamburg passiert, dann ist das genau so ein Schritt der viele Zeichen setzt. Jedenfalls hoffe ich, dass er das sein wird. Es gibt einmal die Diskussion darum, was am Joseph-Carlebach-Platz entstehen soll und die Frage nach Bornplatz-Synagoge und ob sie historisch oder modern oder ganz anders wieder aufgebaut werden soll. Es gibt Ansätze, die jüdischen Friedhöfe wieder in einen besseren Zustand zu versetzen, denn auch Friedhöfe sind ein Alltagsgegenstand und alltagsrelevant, haben also was mit heutigem jüdischen Leben zu tun. Und es gibt eben den Ansatz die Polstraße zu entwickeln. Und da wären wir bei so was, wo ich sagen würde, es handelt sich um mehr als ein Zeichen. Weil die Polstraße ein kultureller Ort ist, den die Stadtgesellschaft wirklich gemeinsam entwickeln kann. Also jüdisch und nicht-jüdische Stimmen, Künstler, Denkmalschützer, Historiker, Anwohner und Anwohnerinnen. Also ich wäre eher für die Vielzahl der Zeichen, die man setzen müsste und zu versuchen, eine gewisse Normalität herzustellen. Mit Normalität meine ich natürlich nicht, dass man endlich den NS oder die Auseinandersetzung damit hinter sich lässt, sondern dass man sagt, trotz des NS, trotz dieser belasteten Vergangenheit gibt es ein Miteinander und auch ein Nebeneinander, das es auch aushält, dass es sich widerspricht und teilweise auch streitet. Also, dass auch die jüdische Gemeinschaft eine zerstrittene Gemeinschaft ist und, dass das nicht schlecht ist, sondern, das das letztlich einfach ein Ausdruck von menschlichem Miteinander ist, dass es unterschiedliche Positionen gibt, die sich nicht immer alle deckungsgleich einig sein müssen. Das wäre ein guter Ansatz, Streit zulassen und sich dadurch am Pluralismus freuen.
Ganz herzlichen Dank liebe Frau Rürup, das war ein wunderbares Gespräch, vielen Dank.
Das war unser History and Politics Podcast mit Miriam Rürup zur Entwicklung und Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland seit 1945.
Wenn Sie mehr wissen wollen über die Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens in Deutschland und Europa, schauen Sie gern auf die Website des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam. Regelmäßig finden dort öffentliche Vorträge und Veranstaltungen statt. Oder Sie besuchen die Internetseite des Instituts für die Geschichte der Deutschen Juden in Hamburg; auch dort finden sich interessante Online-Ausstellungen, Vorträge und sogar eine eigene Podcast-Reihe.
Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereich Geschichte und Politik der Körber-Stiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Dort gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts.
Das war´s für heute, ich danke Ihnen für das Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt.

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 Min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 Min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 Min. 26. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 Min. 12. Mrz 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 Min. 5. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 Min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 Min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 Min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 Min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 Min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 Min. 12. Dez 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 Min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 Min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 Min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 Min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 Min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 Min. 30. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 Min. 9. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 Min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 Min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 Min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 Min. 28. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 Min. 14. Mrz 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 Min. 7. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 Min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 Min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 Min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 Min. 6. Dez 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 Min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 Min. 21. Okt 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 Min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 Min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 Min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 Min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 Min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 Min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 Min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 Min. 31. Mai 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 Min. 3. Mai 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 Min. 8. Mrz 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 Min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 Min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 Min. 28. Okt 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 Min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 Min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 Min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 Min. 25. Mrz 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 Min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 Min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 Min. 17. Dez 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 Min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 Min. 19. Okt 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 Min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 Min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 Min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 Min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 Min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 Min. 6. Mai 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 Min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 Min. 27. Mrz 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 Min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 Min. 23. Okt 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 Min. 1. Okt 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 Min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 Min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 Min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 Min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 Min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 Min. 28. Mai 2019